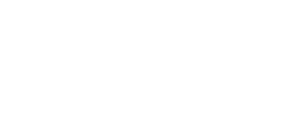Beschluss vom 08.06.2023, Az.: 5 K 171/22
In dem vorstehenden Rechtsstreit hat das Nds. OVG entscheiden, dass es voraussichtlich einer umfassenden Einzelfallprüfung bedürfe, ob die Photovoltaikanlage trotz fehlender Genehmigung unter Achtung des Denkmalschutzes zulässig ist. Im Eilrechtsschutz hat das die Folge, dass der Hauseigentümer seine ungenehmigte Photovoltaikanlage zunächst wieder abbauen muss.
Relevanz: Das Nds. OVG befasst sich in seinem Beschluss mit der Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Errichtung von Anlagen zur Nutzung von erneuerbaren Energien und dem Interesse an der unveränderten Erhaltung des Kulturdenkmals aus § 7 Abs. 2 Nr. 3 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (kurz: NDSchG).
Nach einigen Entscheidungen in letzter Zeit, die das überragende öffentliche Interesse an der Errichtung erneuerbarer Energien-Anlagen aus § 2 EEG 2023 deutlich gemacht haben, gibt es nun eine Entscheidung zulasten der Errichtung von erneuerbaren Energien-Anlagen.
Hintergrund: Der Eigentümer eines denkmalgeschützten Gebäudes hatte ohne die erforderliche denkmalrechtliche Genehmigung eine Photovoltaikanlage errichtet, die einen Großteil der straßenabgewandten Seite des Daches überdeckte, farblich nicht an das Dach angepasst war und generell keine einheitliche Farbgebung aufwies. Die Stadt Goslar ordnete den Abbau der Photovoltaik an. Der Eigentümer ersuchte Eilrechtsschutz gegen die Anordnung zum Abbau, dem das VG Braunschweig stattgab. Dagegen legte die Stadt Goslar wiederum Beschwerde ein, die vor dem Nds. OVG erfolgreich war – die Photovoltaikanlage muss abgebaut werden.
Das Nds. OVG hat entschieden, dass es im vorliegenden Fall voraussichtlich einer umfassenden Einzelfallprüfung zur Frage bedurft hätte, ob die Abwägung gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 3 NDSchG zugunsten des öffentlichen Interesses an der Errichtung von Anlagen zur Nutzung von erneuerbaren Energien ausfallen würde. Im Rahmen der „summarischen Prüfung“ im Eilrechtsschutz bedeutet dies, dass die Photovoltaikanlage nach derzeitiger Aktenlage nicht offensichtlich genehmigungsfähig war und die Abwägung daher nicht zugunsten des Eigentümers ergehen konnte.
Nach § 7 NDSchG ist ein Eingriff in ein Kulturdenkmal bei der Errichtung von erneuerbaren Energien-Anlagen im Regelfall zu genehmigen. Dem Regelfall stünde hier laut dem Senat aber entgegen, dass das betroffene Denkmal in der als UNESCO-Weltkulturerbe besonders geschützten Altstadt von Goslar liegt. Daher bedürfe es hier einer umfassenden Prüfung des Einzelfalls, die im Eilverfahren aufgrund der Dringlichkeit nicht durchgeführt wird.
Anfang diesen Jahres entschied das OVG Greifswald im Zusammenhang mit dem Bau einer Windenergieanlage in die entgegengesetzte Richtung: Das Denkmalschutzinteresse muss im Einzelfall zurückstehen aufgrund des überragenden öffentlichen Interesses an der Errichtung und dem Betrieb von erneuerbaren Energien-Anlagen aus § 2 EEG.
Der Beschluss des Nds. OVG kann nicht mit Rechtsmitteln angefochten werden. Allerdings könnte die Entscheidung im Hauptsacheverfahren theoretisch anders ausfallen. Die Entscheidungsgründe liegen noch nicht vor. Näheres kann in der Pressemitteilung des Nds. OVG nachgelesen werden.