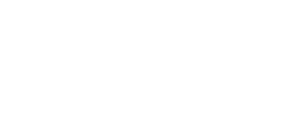In diesem #RGCfragtnach stellt Dr. Franziska Lietz 5 Fragen an Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter Martin Gehlen von der auf Sanierung, Restrukturierung und Insolvenzrecht spezialisierten Kanzlei WILLMERKÖSTER. Es geht um den Umgang mit drohenden Liefer- bzw. Zahlungsschwierigkeiten bei produzierenden Unternehmen und welche Handlungsweisen in diesen Fällen zu empfehlen sind.
RGC: Im Moment hören wir von vielen Mandanten, dass diese entweder ihren Gasliefervertrag durch Insolvenz des Lieferanten oder Lieferstopp verloren haben und auf die Möglichkeit verwiesen sind, Gas zu sehr hohen Preisen am Spotmarkt einzukaufen. Die Folge ist häufig, dass es sich nicht mehr rentiert, das Produkt herzustellen, weil es zu den erhöhten Produktionskosten am Markt nicht mehr abgenommen wird. Eine andere Variante ist auch, dass der Mandant bei seinen Abnehmern Preisbindungen unterliegt, die bei den hohen Produktionskosten es nicht mehr zulassen, wirtschaftlich zu produzieren. Viele Mandanten erwägen daher aktuell einen „Habeckschen Produktionsstopp“. Wie sind diese Situationen insolvenzrechtlich einzuordnen?

Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter Martin Gehlen, Kanzlei WILLMERKÖSTER
Gehlen:
Für Unternehmen bestehen mit der Zahlungsunfähigkeit und der Überschuldung zwei sogenannte Insolvenzeröffnungsgründe, die jedenfalls juristische Personen, wie eine GmbH, eine GmbH & Co. KG oder eine AG, dazu verpflichten, rechtzeitig einen Insolvenzantrag zu stellen.
Zahlungsunfähigkeit liegt vor, wenn 10% oder mehr der aktuell fälligen Verbindlichkeiten nicht mehr bezahlt werden können.
Überschuldung liegt vor, wenn für das Unternehmen keine Fortführungsperspektive mehr besteht und die Schulden von dem Vermögen des Unternehmens nicht mehr gedeckt sind.
Ab dem Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung ist der Geschäftsführer bzw. Vorstand dazu verpflichtet, innerhalb von drei Wochen einen Insolvenzantrag zu stellen. Wird ein Insolvenzantrag erst nach Ablauf dieser drei Wochen gestellt, ist dies nicht mehr „rechtzeitig“.
RGC: Welche Risiken ergeben sich aus dieser Situation für das Unternehmen und welche Neuerungen plant die Politik im Hinblick auf die Eigenverwaltung?
Gehlen:
Trotz der aktuell massiven Probleme für Unternehmen, insbesondere aufgrund von steigenden Energie- und Personalkosten sowie der Lieferkettenproblematik, hat sich die Bundesregierung bislang gegen eine Aussetzung der Insolvenzantragspflicht entschieden. Wer also zahlungsunfähig oder überschuldet ist, ist also weiterhin verpflichtet, einen Insolvenzantrag zu stellen.
In ihrem Maßnahmenpaket geht es der Regierung darum, „unnötige Insolvenzen aus Unsicherheit“ zu vermeiden. So soll beim Insolvenzgrund der Überschuldung übergangsweise gelten, dass der Fortbestand des Unternehmens (Fortführungsprognose) nicht mehr über 12, sondern nur noch über vier Monate hinweg überwiegend wahrscheinlich ist.
Zudem plant das Bundesjustizministerium Erleichterungen bei der Eigenverwaltung. Voraussetzung für die Anordnung der Eigenverwaltung war bisher die Einreichung eines Planes, aus dem sich ergibt, dass die Fortführung des Unternehmens für einen Zeitraum von sechs Monaten gesichert ist. Dieser Zeitraum soll von sechs auf vier Monate herabgesetzt werden.
RGC: Welche Vorteile bietet es, wenn das Unternehmen in die Eigenverwaltung geht im Gegensatz zu einer „klassischen Insolvenz“?
Gehlen:
Die Sanierung im Rahmen eines Schutzschirmverfahrens oder einer Eigenverwaltung bietet gegenüber einem Regelinsolvenzverfahren zahlreiche Vorteile. Letztlich führt das Regelinsolvenzverfahren zur Bestellung eines (vorläufigen) Insolvenzverwalters und damit zu einem Kontrollverlust für die Geschäftsführung, da im Ergebnis der (vorläufige) Insolvenzverwalter über das Schicksal des Unternehmens entscheidet. Die Vorteile bei einer (vorläufigen) Eigenverwaltung und einem Schutzschirmverfahren bestehen darin, dass die Geschäftsleitung im Amt bleibt und diese von einem Sanierungsberater unterstützt wird, der das Unternehmen wie ein Lotse durch das Verfahren führt. Diesen Sanierungsberater kann sich das Unternehmen selbst aussuchen, indem es ihm ein Mandat erteilt. Zusätzlich wird bei der Eigenverwaltung vom Gericht ein (vorläufiger) Sachwalter eingesetzt, der als verlängerter Arm des Gerichts lediglich eine Kontroll- und Überwachungsfunktion ausübt, jedoch nicht operativ in das Unternehmen eingreift. Zudem werden weder die Anordnung der Eigenverwaltung, noch des Schutzschirmverfahrens veröffentlicht, so dass Dritte davon, jedenfalls bis zur Eröffnung des Verfahrens, keine Kenntnis erlangen. Die Dauer eines solchen Verfahrens, insbesondere in Verbindung mit der Erstellung eines Insolvenzplanes, kann in der Regel auf sechs bis neun Monate verkürzt werden, was sich ebenfalls meist positiv auf Vertragsbeziehungen des Unternehmens auswirkt. Schließlich bieten sowohl die Eigenverwaltung, als auch das Schutzschirmverfahren Unternehmen die Möglichkeit, durch die Inanspruchnahme von Insolvenzgeld für bis drei Monate Liquidität zu generieren, da die Personalkosten für diesen Zeitraum vom Staat übernommen werden.
Durch die Möglichkeit, ein solches Verfahren mit einem Insolvenzplan zu verbinden, besteht ferner die Möglichkeit, das Unternehmen als solches zu erhalten, was insbesondere für die Gesellschafter attraktiv ist, da sie weiterhin die Anteile an dem Unternehmen halten.
RGC: Darüber hinaus können den Leitungsorganen von Unternehmen auch persönlich erhebliche Risiken drohen, wenn das Unternehmen in Schieflage geraten ist und bestimmte Schritte zu spät ergriffen werden. Welche sind das?
Gehlen:
Liegt entweder eine Zahlungsunfähigkeit oder eine Überschuldung vor, ist die Geschäftsleitung verpflichtet, innerhalb von drei bzw. sechs Wochen einen Insolvenzantrag zu stellen. Macht sie dies nicht rechtzeitig, führt dies zum einen zu einer strafbaren Insolvenzverschleppung und zum anderen drohen Schadensersatzansprüche, für die sie mit ihrem Privatvermögen haftet.
RGC: Welche ersten Schritte kannst Du Unternehmen bzw. ihren Geschäftsführern oder Vorständen, bei denen es wirtschaftlich aktuell „knapp“ ist, aktuell raten?
Gehlen:
Die Situation ist für Unternehmen derzeit äußerst schwierig, insbesondere bei einem vom Versorger gekündigten Energielieferungsvertrag. Wird ein (neuer) Energielieferungsvertrag zu deutlich höheren Konditionen unterschrieben, sind diese höheren Kosten in der Liquiditätsplanung des Unternehmens zu berücksichtigen, was kurz- oder auch mittelfristig zu einer Zahlungsunfähigkeit oder auch Überschuldung führen kann. Wird ein solchen Vertrag hingegen nicht unterschrieben, ist die Fortführung des Betriebes nicht gesichert und die zu erstellende Führungsperspektive negativ, was bei gleichzeitig bestehender Überschuldung ebenfalls zu einer Insolvenzantragspflicht führen kann.
Bei der Abwägung der (überschaubaren) Kosten für eine Beratung auf der einen Seite und der persönlichen Haftungsrisiken für Geschäftsführer und Vorstände auf der anderen Seite sollten Unternehmen ihren aktuellen Status einer möglicherweise drohenden oder bereits bestehenden Insolvenzantragspflicht rechtzeitig von Spezialisten überprüfen lassen.
RGC: Ich danke Dir ganz herzlich für das Interview!